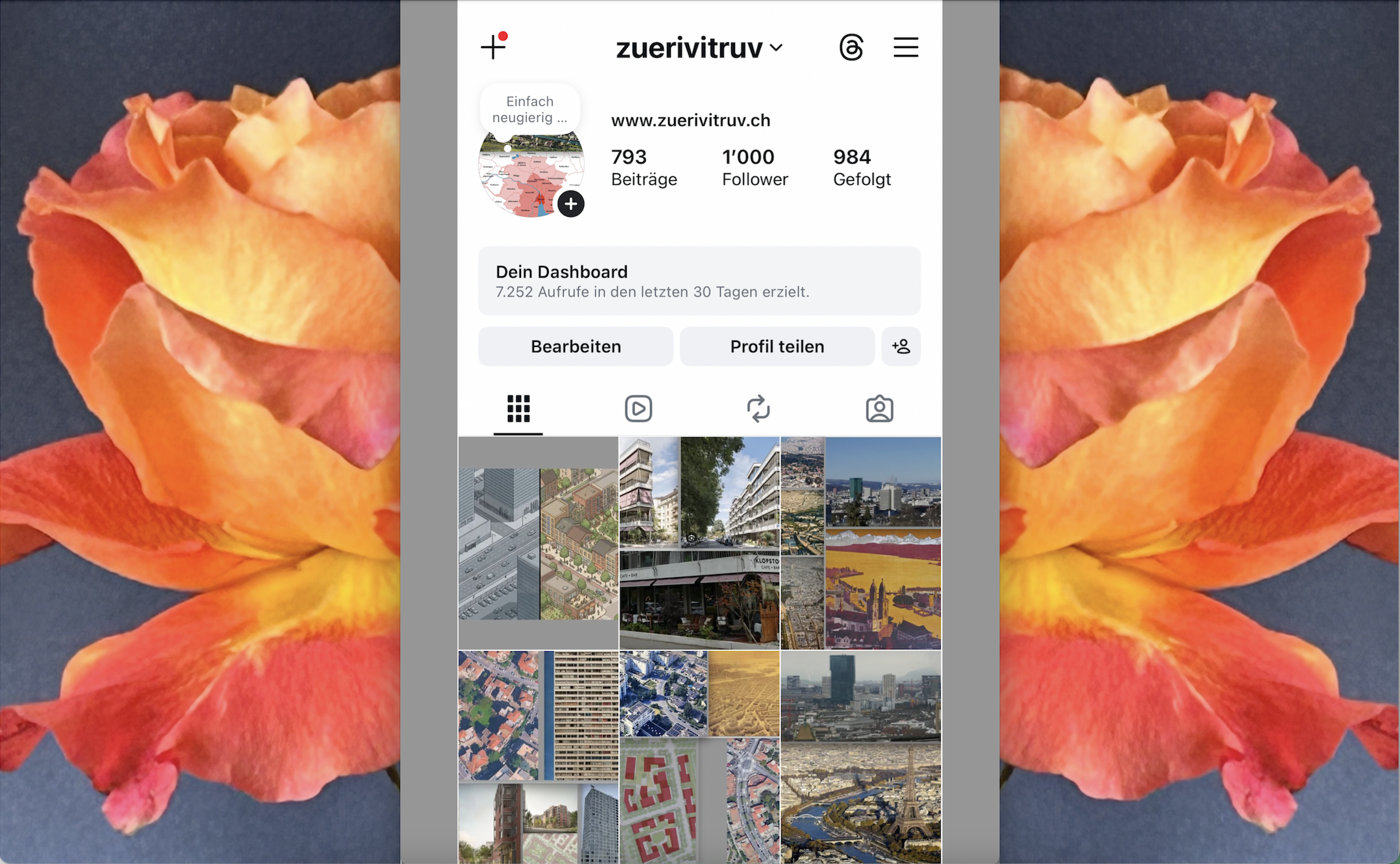Im vorgängigen Kandidaten-Posting blickte Ihnen der kritische Kopf auf dem Schlussstein über dem Eingang des Schulhauses Hirschengraben (1892) in die Augen. Der Architekt soll ihn als Botschaft an die Jugend bestellt haben. Die in diesem Posting gezeigte, inzwischen etwas verblichene Fotografie, erinnert an die kantonale Kriegserklärung an unser Stadtbild im Jahr 2014. Der 6 Mia schwere kantonale Angriff auf den Hangfuss des Zürichbergs hat im städtischen Hochbaudepartement keinerlei Widerstand ausgelöst. An der Vorstellung im grossen Auditorium der Universität haben besorgte Bewohner den städtischen Bauvorstand angefragt und wurden an den Kanton verwiesen. «Aber dieser Eingriff geschieht doch in – unserem – Stadtkörper!». Fünf Jahre später haben vier beherzte Anwohner vor Gericht gewonnen. Dann folgten Verhandlungen. Die 600 Meter lange und 50 Meter hohe Hochhauskulisse hat eine Absenkung von bis zu 30 Metern erfahren. Ein Fall von «Bewohnerstädtebau». Jetzt drehen sich die Kräne.
Historiker werden einst der Frage nachgehen, wie eine solche Fehlleistung überhaupt zustande kommen konnte. Der Standortentscheid, das Kantonsspital in Zürich statt in Dübendorf zu erweitern spielte eine Rolle, aber auch das über 6 Jahre gewachsene Raumprogramm, das dann einfach als Volumenzunami auf den Hang losgelassen wurde. Das durch die Absenz von Städtebau erzeugte Vakuum machte es möglich.
Aus diesem Grund veröffentlichte Prof. Jürg Sulzer am 18. Mai 2024 in der NZZ am Sonntag den Artikel mit dem Titel: «Auch Zürich hat ein Anrecht auf guten Städtebau».